
Lohnen sich Mikro-Windanlagen?
Die großen Windräder auf Feldern, Bergen und dem Meer tragen maßgeblich zur Energiewende in Deutschland bei. Längst gibt es sie auch eine Nummer kleiner, um grünen Strom zu erzeugen. Doch rechnet sich das überhaupt? Wir klären es.
Grünstrom nachts und ohne Sonne erzeugen
Strom aus erneuerbaren Quellen selbst erzeugen und sich unabhängiger von hohen Strompreisen machen – dies wünschen sich viele Haus- und Kleingartenbesitzer. Neben den bewährten und vielerorts verbauten Solarstrom-Anlagen auf Dächern oder Freiflächen rücken auch Mikro-Windräder bzw. Kleinwind-Anlagen immer häufiger in den Fokus. Sie sind kompakter und kleiner, erzeugen aber natürlich deutlich weniger Strom als ihre großen Pendants auf dem Land. Da sie aber im Gegensatz zu PV-Anlagen auch nachts und an sonnenarmen Tagen – speziell im Herbst und Winter – Strom erzeugen können, sind sie für private Solarstrom-Erzeuger eine durchaus interessante Ergänzung.
Grundlegend lassen sich zwei Varianten unterscheiden: Anlagen mit horizontalen Achsen und klassischen Rotoren wie bei großen Windrädern. Stehen sie optimal im Wind, garantieren sie die höchste Leistung. Dafür müssen sie sich aber flexibel an die jeweilige Windrichtung anpassen lassen können. Alternativ sind Anlagen mit vertikalen Achsen und spiralförmigen Rotoren auf dem Markt. Ihr Wirkungsgrad ist niedriger, dafür laufen sie unabhängig von der Windrichtung und sind leiser als horizontale Anlagen.
Worauf zu achten ist
Ganz unabhängig von der Art der Anlage, sollte vorab eine ganz entscheidende Frage geklärt werden: Sind überhaupt genügend Wind und geeignete Flächen vorhanden? Erst ab konstanten Windgeschwindigkeiten von 10 m/s liefern Mikro-Windanlagen ihre volle Leistung. Dies entspricht Windstärke 5 – also einem frischen Wind, bei dem sich auch größere Zweige und Bäume bewegen und der Wind deutlich hörbar ist. Dies ist vor allem in flachen, nördlichen Regionen oder auf Hügel- und Bergkuppen der Fall. Zudem sollte eine Fläche frei sein, bei der der Wind aus westlicher Richtung weitgehend ungehindert auf die Anlage trifft.
Ein freier, weitläufiger Garten ist für Mikro-Anlagen dabei der bessere Standort als ein Dach. Zum einen könnten die Vibrationen der Windanlage statische Schäden am Haus verursachen. Außerdem wären die Geräusche der Rotoren eventuell auch im Haus hörbar. Im Garten sollte natürlich darauf geachtet werden, dass keine Bäume oder andere Gebäude in der zentralen Windrichtung stehen. Anlagen in dicht bebauten Stadtbereichen sind daher keine gute Idee.
Ein weiteres wichtiges Thema: Baugenehmigung. In den meisten Bundesländern müssen Anlagen bis 10 Meter Höhe nicht extra genehmigt werden lassen. Allerdings sollte sich mit den Nachbarn über mögliche Lärm- oder Sichteinschränkungen abgesprochen werden. So oder so müssen Kleinwind-Anlagen aber beim regionalen Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur als Stromerzeugungsstelle angemeldet werden.
Lohnt es sich?
Dies lässt sich nur im Vergleich mit den Strompreisen des aktuell gewählten Anbieters sowie den gesamten Kosten der Mikro-Windanlage beantworten. Kommen Sie also mit den Anschaffungs-, Wartungs- und Reparaturkosten der Anlage und der tatsächlich erzeugten Stromleistung auf einen kWh-Preis, der unterhalb der durchschnittlichen 30 Cent pro kWh liegt, lohnt es sich. Je nach Leistung, Modell und Bauhöhe kosten kleine Windanlagen zwischen 3.000 und 9.000 Euro pro Kilowatt. Hier muss also individuell abgewogen werden.
Nur ist dabei zu bedenken, dass die erzeugte Leistung sehr abhängig vom durchschnittlichen Windaufkommen sowie der Lage der Anlage ist. Und es wird sicherlich nie ausreichen, um den gesamten Strombedarf eines Einfamilienhauses zu decken. Aber als Ergänzung und um langfristig die Stromkosten zu senken, kann eine Mikrowindanlage durchaus lohnen. Günstige Einstiegsanlagen für 200 bis 500 Euro sind übrigens nur für Hobby-Anwendungen, Boote oder Gartenhäuser geeignet.
Bildnachweis: © Bilanol (istockphoto)
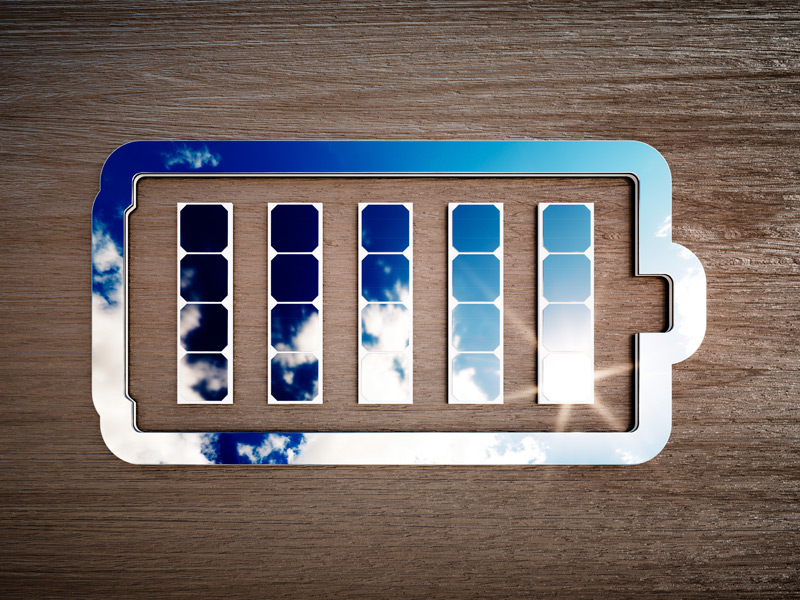
Solarstrom speichern und selbst nutzen
Immer mehr private Haushalte und Unternehmen setzen auf die Sonne als günstige und saubere Stromquelle. Doch was ist, wenn an sehr sonnigen Tagen mehr Strom erzeugt wird, als für den Eigenbedarf nötig ist? Ins öffentliche Netz einzuspeisen, lohnt sich kaum noch. Selbst speichern dagegen schon. Wir erklären, wie es funktioniert.
Mehr Unabhängigkeit vom Strommarkt
Die Lösung steht oft im Keller: Dort installieren mittlerweile viele Betreiber von Photovoltaik-Anlagen eigene Stromspeicher, um nicht benötigten Solarstrom für später zu sichern. Private Haushalte verbrauchen zum Beispiel früh und abends mehr Strom; doch die meiste Energie entziehen die PV-Module der Sonne in den Mittagsstunden – wenn kaum jemand zuhause ist.
Viele Jahre stellte das kein Problem dar: Überschüssiger Strom wurde in das lokale Stromnetz eingespeist. Anfangs war dies sehr lukrativ, weil die Bundesregierung die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien mit hohen Vergütungssätzen finanziell förderte. In den vergangenen Jahren sind die Beträge jedoch so weit gesunken, dass es sinnvoller ist, den eigenen Strom auch selbst zu verbrauchen.
Dabei gilt ebenfalls: Wer mehr Strom günstig und sauber selbst erzeugt, macht sich unabhängiger von künftigen Preisschwankungen der örtlichen Stromanbieter und senkt nachhaltig seine jährliche Stromrechnung. Günstiger ist der eigene Solarstrom meist in jedem Fall – denn es müssen keine Stromsteuer, Netzentgelte und andere Umlagen mitgezahlt werden, die Stromanbieter an ihre Kunden weiterreichen. So sind in den letzten zehn Jahren die Strompreise immerhin um rund 25 Prozent gestiegen.
Wie Solarstrom-Speicher funktionieren
Solarstrom-Speicher sind heute in erster Linie Lithium-Ionen-Batterien, wie sie auch bei Elektro-Autos eingesetzt werden. Sie sind zwar teurer als die vorher weit verbreiteten Blei-Akkus, punkten aber mit längerer Lebensdauer, höherem Wirkungsgrad, mehr Ladezyklen und geringem Wartungsaufwand. Vier kWh Speicherkapazität reichen dabei bereits für einen Vier-Personen-Haushalt.
Die Solarstrom-Speicher sind in das System der PV-Anlage integriert und in den Kreislauf meist automatisch eingebunden. Aktive Geräte werden dabei direkt mit dem Strom aus der PV-Anlage versorgt. Nicht benötigter Strom fließt in die Batterie und kann später genutzt werden. Sollte die wiederum vollgeladen sein, werden weitere Überschüsse in das Stromnetz gespeist. Andersherum wird extern Strom bezogen, sobald die Sonne fehlt und die Speicherkapazitäten erschöpft sind.
Ein geeigneter Platz für den Stromspeicher ist übrigens das gesamte Jahr über eher kühl. Optimal sind Raumtemperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Über 25 Grad verringert sich die Lebensdauer der Batterien deutlich.
Kosten und Fördermöglichkeiten
Bei den Kosten gibt es gute Nachrichten: Seit Jahren sinken die Preise für Lithium-Ionen-Solarstromspeicher. Bei kleinen Geräten haben sie sich innerhalb von fünf Jahren halbiert. Aktuell bewegen sich die Preise zwischen 1.200 und 1.900 Euro pro kWh. Dazu kommen noch Installationskosten. Sie sind abhängig vom Aufwand des Einbaus, hier sollte mit 900 bis 2.500 Euro gerechnet werden.
Ein Stromspeicher ist also keine kleine Investition – sie lässt sich aber durch Förderprogramme abfedern. Zwar wurde das KfW-Förderprogramm für Batteriespeicher Ende 2018 beendet, aber viele Bundesländer und Städte bieten eigene Programme an. Denn die Vorteile des gespeicherten Solarstroms liegen auf der Hand.
Bildnachweis: © Petmal (istockphoto)

Brennstoffzelle – die vielseitige Energiequelle
Strom und Wärme fürs eigene Haus selbst erzeugen – mit einer Brennstoffzelle ist dies möglich und mittlerweile auch für Privatnutzer wirtschaftlich interessant. Wir zeigen Ihnen, für wen die moderne, stromliefernde Heizung geeignet ist, welche Vorteile sie hat und mit welchen Kosten zu rechnen ist.
Vorteile der Brennstoffzelle
Brennstoffzellen-Heizungen funktionieren nach der Kraft-Wärme-Kopplung, das heißt, sie erzeugen durch die elektrochemische Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff sowohl Wärme für Heizung und Warmwasser als auch Strom. Geeignet sind sie besonders für Besitzer von Ein- oder Zweifamilienhäusern sowie Kleingewerben. Denn die heutigen Geräte erreichen einen äußerst hohen Wirkungsgrad. Um bis zu 40 Prozent lassen sich dadurch die Heizkosten senken, zugleich schonen Brennstoffzellen dank geringerer CO2-Emissionen das Klima. Die selbst gewonnene elektrische Energie reduziert zudem die Stromkosten und macht Sie unabhängiger von Preisschwankungen. Und das auf geringer Fläche: Meist benötigen die Heizgeräte nur einen Quadratmeter Platz und arbeiten sehr leise – es braucht demnach auch keine weitere Lärmdämmung im Haus.
Voraussetzungen und Kosten
Wenn Sie von den Vorteilen einer Brennstoffzellen-Heizung profitieren möchten, sollten verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein: Ihr Haus braucht einen Gasanschluss, da der Wasserstoff aus Erdgas gewonnen wird. Außerdem ist eine zentrale Heizungsanlage nötig, weil Sie die gesamte erzeugte Wärme selbst verbrauchen müssen. Den Strom können Sie ebenfalls für den Eigenbedarf verwenden – es ist aber ebenso möglich, Überschüsse in das öffentliche Netz einzuspeisen. Investiert werden sollte auch in einen Wärmespeicher – so sichern Sie sich eine gleichmäßige Komforttemperatur und Stromzufuhr. In der Regel ist in heutigen Geräten eine Zusatzheizung integriert. Denn die Brennstoffzellen-Heizung deckt nur den Grundbedarf an Wärme und Strom – in Spitzenzeiten wie den Wintermonaten steuert die Extra-Heizung dann das notwendige Mehr an Wärme bei.
Für die Anlage an sich sollten Sie zwischen 20.000 und 30.000 Euro einplanen. Dazu summieren sich eventuell Baukosten für den Gasanschluss sowie Leitungen im Haus. Pro Jahr kommen zudem Wartungskosten von rund 500 Euro hinzu.
Brennstoffzellen-Heizung fördern lassen
Die Investitionskosten fallen also etwas höher als bei konventionellen Heizanlagen aus. Aber: Bund sowie einige Länder, Städte und Stadtwerke unterstützen Hausbesitzer mit verschiedenen Förderprogrammen beim Kauf einer stromerzeugenden Heizung. Beispielsweise die KfW: Sie zahlt mit dem Programm 433 „Energieeffizient Bauen und Sanieren – Zuschuss Brennstoffzelle“ einen Grundbetrag von 5.700 €. Der erhöht sich je nach Stromleistung Ihrer Anlage. 450 Euro pro 100 Watt elektrischer Leistung kommen so oben drauf.
Inwieweit sich eine Brennstoffzellen-Heizung langfristig auszahlt, hängt vom jeweiligen Energiebedarf ab. Wenn Sie über das gesamte Jahr Wärme und auch viel Strom verbrauchen, rentieren sich die Anlagen schnell – besonders in Gebäuden mit hoher Energieeffizienz.
Bildnachweis: © Petmal (istockphoto)